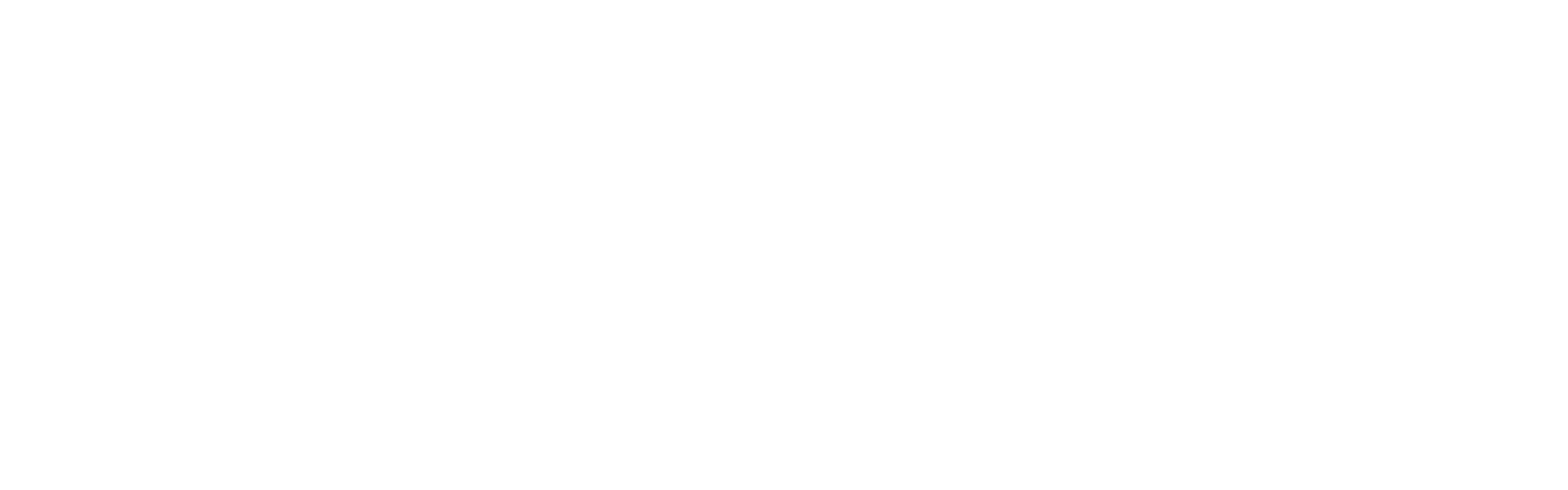Folge 8:
Künstliche Intelligenz in der Medizin
Das Jahr 2023 scheint das Jahr der Künstlichen Intelligenz zu werden. In der Medizin findet KI als Werkzeug schon länger Anwendung. Doch wie genau setzen das Medizinerinnen und Mediziner ein? Was sind die Anforderungen, damit KI-gestützte Diagnoseverfahren korrekte Ergebnisse liefern? Prof. Dr. Christoph Lippert vom Hasso-Plattner-Institut der Universität Potsdam gibt Antworten.

Zu Gast: Prof. Dr. Christoph Lippert
Leitung Fachgebiet Digital Health – Machine Learning am HPI
Prof. Christoph Lippert leitet das Fachgebiet Digital Health – Machine Learning am Hasso-Plattner-Institut der Universität Potsdam. Der Forschungsschwerpunkt seines Teams liegt auf der Theorie des Maschinellen Lernens und der Künstlichen Intelligenz und wie diese auf medizinische Daten angewendet werden können.
Machine Learning: maschinelles Lernen
Wie können Maschinen auf Anforderungen reagieren, für die sie nicht programmiert wurden? Lösungen dafür bietet das machine learning, ein Teilbereich der künstlichen Intelligenz. Dabei geht es darum, Algorithmen und Modellen zu entwickeln, die es Computern ermöglichen, aus Erfahrungen zu lernen und Aufgaben zu automatisieren, ohne explizit programmiert zu werden. Computer sollen damit die Fähigkeit erhalten, Muster und Zusammenhänge in Daten zu erkennen und daraus Vorhersagen oder Entscheidungen zu treffen.
Anwendungsbereiche in der Medizin sind zum Beispiel:
- Krankheitsdiagnose und Bilderkennung
- Personalisierte Behandlung und Medikamentenentwicklung
- Überwachung und Früherkennung von Gesundheitsproblemen
- Prognose und Risikobewertung von Krankheiten
- Datenanalyse und klinische Entscheidungsunterstützung
Machine Learning-Modelle in der Medizin dienen als unterstützende Werkzeuge für Ärztinnen, Ärzte und medizinisches Fachpersonal und nicht als Ersatz für eine fundierte medizinische Ausbildung und Erfahrung.
Narrow Artificial Intelligence & Generative Artificial Intelligence
Es gibt verschiedene Komplexitätsstufen von Künstlicher Intelligenz. Eine grobe Unterscheidung bieten die Begriffe Narrow und Generative Artificial Intelligence.
Artificial Narrow Intelligence (ANI) oder auch weak AI – schwache KI – bezieht sich auf künstliche Intelligenz, die auf eine spezifische Aufgabe oder ein bestimmtes Fachgebiet beschränkt ist und nicht in der Lage ist, außerhalb dieses Kontexts zu generalisieren. ANI-Systeme verwenden Technologien wie maschinelles Lernen und Deep Learning, um spezifische Probleme zu lösen, wie zum Beispiel Bilderkennung, Spracherkennung oder Übersetzung. Aktuell arbeiten die meisten medizinischen KI-Systeme mit ANI.
Generative Artificial Intelligence (GAI) – oder auch strong AI, starke KI – bezieht sich auf künstliche Intelligenz, die in der Lage ist, eigenständig neue Inhalte, Texte, Bilder oder andere kreative Outputs zu generieren. GAI-Systeme nutzen bestimmte Techniken, um neue Inhalte zu erstellen, die auf dem Training mit vorhandenen Daten basieren, aber auch eigenständig "neue" Daten erzeugen können, die ähnlich den trainierten Daten sind.
Trainingsdaten für KI und Bias
Trainingsdaten für KI im medizinischen Kontext sind Datensätze, die verwendet werden, um KI-Modelle aufzubauen und zu trainieren. Diese Daten enthalten typischerweise Informationen wie medizinische Aufzeichnungen, Bildgebungsdaten, Patientendaten und andere relevante Informationen. Anhand dieser Daten kann ein Computer Schlüsse für ein Individuum ziehen.
Sind die Trainingsdaten allerdings nicht ausreichend, um die Verfassung der zu untersuchenden Person vollumfänglich zu beschreiben, kann ein
Bias entstehen. Zum Beispiel, wenn eine KI-Anwendung, die mit Daten von Männern trainiert wurde, auf eine Frau angewendet werden soll. Ein Bias entsteht dann, wenn Daten nicht repräsentativ für die gesamte Bevölkerung oder bestimmte Bevölkerungsgruppen sind; für diese aber angewendet werden. Das kann im Anwendungsfall zu ungleichen oder ungenauen Vorhersagen und Entscheidungen führen.
Transkript der Podcast-Folge
-
Minute 00:00 bis 06:04
Prof. Dr. Christoph Lippert: Im Endeffekt ist die Digitalisierung eine Voraussetzung für die Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz.
Alissa Stein: NewHealth.Podcast – Digitalisierung sinnvoll umsetzen. Der Talk mit Expertinnen und Experten zur Digitalisierung des Gesundheitswesens.
Prof. Dr. Sebastian Kuhn: Mit Sebastian Kuhn.
Alissa Stein: Professor für digitale Medizin. Und mit mir, Alissa Stein als Moderatorin.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum NewHealth.Podcast. Auch dieses Mal haben wir wieder eine ganz spannende Folge für Sie. Wir sprechen nämlich über das Thema Künstliche Intelligenz in der Medizin und widmen uns der Frage, wie Maschinen eigentlich lernen können. Wir, das bedeutet natürlich auch, dass Professor Sebastian Kuhn wieder an meiner Seite ist. Hallo Herr Kuhn! Welche Erfahrung haben Sie denn schon mit KI gemacht?
Prof. Kuhn: Ja, Frau Stein, auch von meiner Seite, herzlich willkommen zum Podcast. Ich freue mich, dass wir wieder die Möglichkeit haben, uns zu diesem Thema auszutauschen. Und künstliche Intelligenz ist ein unglaublich spannendes Thema, was mich auch schon gut fünf Jahre wirklich beschäftigt. Wir sind aktuell an einem unglaublich spannenden Zeitpunkt in der Geschichte der Medizin. Durch den digitalen Wandel haben wir eine immer größere Datenmenge aus klinischen Daten, aus OMIX-Daten, aus Bildgebung. Und diese Informationsmenge mit diesem explodierenden medizinischen Wissen auch zu vereinen, verlangt neue Werkzeuge für uns. Und da ist künstliche Intelligenz so unser neues Instrument, mit dem wir besser Diagnosen stellen können, Prognosen abgeben und vielleicht auch Therapie ansprechen vorhersagen. Von daher ein ganz, ganz spannendes Werkzeug für uns Ärztinnen und Ärzte.
Alissa Stein: Ja, Sie haben es ja gerade schon gesagt, Herr Kuhn, wir haben wirklich was ganz Spannendes vor uns. Und vor allem bietet ja KI auch sinnvolle Vorteile, den ich nicht nur als Patientin habe. Wie profitiert denn das medizinische Personal?
Prof. Kuhn: Ja, ich glaube, als Arzt oder Ärztin werden wir ein bisschen so zum Zentaurus, zu Mischwesen aus Mensch und einer zusätzlichen Kompetenz, die wir bisher vielleicht nicht hatten. So ein bisschen wie in der griechischen Mythologie Zentaurus, das Mischwesen aus Mensch und Pferd. Und so können wir unsere ärztlichen Kompetenzen mit maschinellen Kompetenzen auch kombinieren und dadurch weniger Fehler im Rahmen unserer ärztlichen Entscheidungsprozesse auch durchführen.
Alissa Stein: Wunderbar. Also gute Beispiele, dass Digitalisierung tatsächlich für alle Beteiligten Vorteile bringt. Und das gilt natürlich nicht nur für künstliche Intelligenz. Welche weiteren Vorteile die Digitalisierung des Gesundheitswesens bringt, das erfahren Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in unserem Fachmagazin, dem NewHealthGuide. Besuchen Sie gerne unsere Webseite und werfen Sie einen Blick ins Heft. Die Adresse lautet www.newhealth.guide und dort finden Sie nicht nur alle Infos zum Magazin, sondern auch alle Podcast Folgen. Also schauen Sie gerne mal vorbei.
Und jetzt freue ich mich unseren Gast Professor Dr. Christoph Lippert begrüßen zu dürfen. Er forscht zum Thema Machine Learning am Hasso-Plattner-Institut der Universität Potsdam. Das Ziel seiner Arbeit, mittels KI medizinische Daten so zu verarbeiten, dass Krankheiten früher und genauer diagnostiziert werden. Hallo Professor Lippert! Schön, dass Sie heute Zeit für uns haben.
Prof. Lippert: Hallo. Danke für die Einladung.
Prof. Kuhn: Herr Lippert, auch von meiner Seite. Ich muss sagen, ich habe mich ganz, ganz besonders auf das heutige Gespräch gefreut. Und vielleicht zum Einstieg die Frage an Sie: Sie sind ja unglaublich stark in der Forschung. Und wo ist da so Ihr Hauptthemenfeld? Und welche Verknüpfung bietet sich mit der klinischen praktischen Medizin zu diesem Feld?
Prof. Lippert: Ich arbeite an KI Methoden, Machine Learning Methoden. Also ich entwickle quasi Algorithmen und ich überleg mir, wo diese in der Medizin oder auch in der biomedizinischen Grundlagenforschung Anwendung finden könnten. Da kommen meistens schon sehr spezielle Fragestellungen raus, die vielleicht andere Leute, die generisch an Machine Learning Algorithmen in der Informatik arbeiten, nicht unbedingt haben. Anwendungsfelder sind vor allem: Einerseits die Analyse von biomedizinischen Bildern. Auf der anderen Seite Daten aus der Genetik, Genomik. Und wir schauen uns sehr viele große Populationsstudien an oder große klinische Datensätze und versuchen dann im Endeffekt Muster in diesen zu finden, die uns ein Krankheitsrisiko besser beschreiben lassen. Oder vielleicht den, den die Ursache von Krankheit zu finden. Also beispielsweise arbeiten wir im großen Konsortium, wo es darum geht das genetische Risiko von Volkskrankheiten, wie Herz-Kreislauf-Krankheiten besser zu charakterisieren. Dafür schauen wir uns die Daten von fast 2 Millionen Europäern an, für die wir auf der einen Seite deren Genomsequenz haben, auf der anderen Seite eben, ob diese gewisse Erkrankungen haben oder nicht und versuchen, das in Verbindung zu setzen, um das Risiko zu charakterisieren. Andere Projekte, an denen wir arbeiten, ist zu schauen, welche Muster in, sagen wir, 50.000 Hirn-MRTs könnten vererbbar sein. Also sehen wir einen Unterschied in den Gehirnen von Leuten, die eine Mutation in ihrem Genom haben, im Vergleich zu denen, die diese Mutation nicht haben. Zum Beispiel. In all diesen Projekten merken wir aber, dass das gerade im medizinischen Feld über die Annotation von den Daten so ein bisschen Flaschenhals darstellt. Also wir brauchen quasi zum Trennen von diesen Machine Learning Algorithmen - die brauchen immer nicht nur die Daten selber, also Bilder, viele, viele Bilder. Aber sie brauchen auch die Informationen, was wichtige Muster in diesen Bildern sind. Und gerade im medizinischen Bereich ist das immer so ein Flaschenhals. Deswegen überlegen wir uns auch an Methoden, wie wir zum Beispiel Ärzten helfen können, dass sie diese Labels oder diese Annotationen besser oder mehr davon bereitstellen können oder auch mit automatischen Methoden bereitstellen können.
-
Minute 06:04 bis 09:54
Alissa Stein: Das hört sich nach einem unfassbar spannenden Tätigkeitsfeld an, was Sie da haben. Was würden Sie denn auch sagen, was wären Ihrer Ansicht nach aktuell die spannendsten Lösungen im Bereich der KI sind?
Prof. Lippert: Ich finde natürlich die Themenfelder, auf denen ich arbeite, sehr spannend. Also gerade medizinische Bildgebung ist einfach wirklich spannend, weil man in Bildern einfach viel Informationen über Patienten finden kann. Ich finde es spannend, darüber nachzudenken, wie man medizinische Bildgebung zum Beispiel zur Früherkennung einsetzen könnte, zum Screening. Oder wie man mittels Zufallsbefunden - die Leute gehen zum Arzt, bekommen ein Bild gemacht, weil sich irgendwas diagnostiziert werden sollte - Aber man lässt dann auch einen Algorithmus über dieses Bild laufen, das nach Mustern für andere Krankheiten findet und könnte damit zum Beispiel früh andere Krankheiten finden, ohne dass das der Patient schon davon weiß oder irgendwelche Symptome hatte. Also solche solche Sachen finde ich, finde ich extrem spannend.
Prof. Kuhn: Ja, das ist auch von meiner Seite muss ich sagen, was Sie eben gerade skizziert haben: Das ist etwas, was wir auch in der klinisch-praktischen Medizin schon angewandt haben - also diese „Incidental Findings“. Man hat eine Untersuchung gemacht, vielleicht aus einem ganz anderen Anlass, und findet zusätzlich noch weitere Informationen in den Bildern. Das war in meinem Tätigkeitsbereich der Schwerverletztenversorgung: Da bekommen Patienten, die einen schweren Unfall erlitten haben, zum Beispiel mit höherer Geschwindigkeit einen PKW Unfall erleiden. Da können schwere Verletzungen entstehen, aber das muss nicht der Fall sein. Diese Patienten bekommen eine Computertomografie vom Schädel bis runter zum Becken. Und in diesen 2000 Bildern finden wir häufig „incidental findings“ bzw. in einigen Fällen hat man es in der Vergangenheit erst nach ein oder zwei Jahren festgestellt, nämlich dann, wenn die Patienten vielleicht mit einer Tumordiagnose in die Klinik aufgenommen wurden und man die Bilder angesehen hat, die schon mal generiert wurden und gesehen hat, dass dieser Befund vor zwei Jahren – ein kleiner Lungentumor - wahrscheinlich übersehen wurde. Und in dem Bereich haben wir auch schon in, sagen wir mal im Bereich Detektion von primären Lungentumoren oder Lungenmetastasen, ist es wirklich ein spannendes Anwendungsgebiet, was wir auch in der klinischen Medizin versucht haben schon zu integrieren.
Prof. Lippert: Ja, wenn man sich Statistiken anschaut, die von diesen Bevölkerungsstudien wie der UK Bio Bank oder der deutschen Narco Studie anschaut, dann scheint das ja diese incidental findings dann schon in ungefähr 20 % dieser Leute die einer Ganzkörper-Bildgebung sich unterziehen, zu geben. Und das ist wirklich sehr sehr spannend und da wird sich bestimmt viel tun. Natürlich ist immer die Frage, wie man damit umgeht. Also, nur weil man einen kleinen Tumor findet, heißt das ja nicht, dass der unbedingt gefährlich ist oder dass man ihn unbedingt behandeln möchte, weil ich die Leute auch nicht überbehandeln. Aber ich glaube, wenn man, wenn man da mal den richtigen Weg gefunden hat und auch die, die Analysemethoden und das Wissen besser ist, dann ist das eine Riesenchance.
Alissa Stein: Uns interessiert natürlich auch: Wo steht denn Ihrer Ansicht nach Deutschland aktuell? Gibt es vielleicht auch Best Practice Beispiele aus Deutschland?
Prof. Lippert: Also ich meine, Deutschland hat natürlich eine riesige Kompetenz, technisch. Wir haben den Vorteil, dass wir ein öffentliches Gesundheitssystem haben, was relativ standardisiert ist. Das heißt, es wäre auch möglich, wenn man das sozusagen digitalisiert, wenn wir das jetzt schaffen, dann auch systematisch mit diesen Daten zu arbeiten und dort KI-Algorithmen zu entwickeln. Also die Chance ist groß. Allerdings, was eben diese Digitalisierungsansätze sind, da hinken wir ein bisschen hinterher. Das muss man schon so sagen. Leider, leider. Wahrscheinlich liegt es ein bisschen an der in der gesellschaftlichen. zögernden Haltung, dass Leute sich hier sehr viel Gedanken machen, zurechterweise, um die Sicherheit ihrer Daten oder dass diese Daten zu den falschen Zwecken eingesetzt werden.
-
Minute 09:54 bis 16:14
Alissa Stein: Ja, auf jeden Fall natürlich. Thema Datenschutz immer ein riesengroßes Thema. Wie wirkt sich denn der Einsatz von KI auf die tägliche Praxis in Kliniken aus? Was haben Sie da schon beobachten können?
Prof. Lippert: Also ich meine, KI kann natürlich dazu beitragen, dass Arbeitsabläufe effizienter gestaltet werden. Momentan ist es einfach so, dass nicht so viele - ich meine, es sind viele KI-Algorithmen, die sind überall - aber die machen noch nicht sonderlich komplexe Dinge. Also es gibt moderne bildgebende Maschinen, die haben schon implementiert, KI-Algorithmen, die schon so Sachen machen wie Organe markieren oder den Tumor markieren, den sie in dem Bild finden oder Volumen bestimmen und solche Sachen. Aber komplexere Sachen, da ist noch nicht so viel KI im Moment. Wir haben zum Beispiel eine Kollaboration mit Neurochirurgen von der Charité - das ist die Gruppe von Professor Thomas Picht - die viele verschiedene bildgebende Verfahren und Analysemethoden einsetzen, in der OP-Planung. Sie überlegen sich: Wie kann man jetzt, wenn man eine Hirn-OP machen möchte, um zum Beispiel einen Tumor rauszunehmen? Wie schneidet man am besten in das Gehirn rein, um möglichst viel von diesem Tumor und möglichst auch um das Gewebe zu extrahieren, ohne wirklich viel schlimme negative Folgen für den Patienten? Und die setzen natürlich Bild-Analyseverfahren ein. Aber das ist irgendwie, das sind viele verschiedene Algorithmen, die dann sehr kompliziert händisch zusammengefügt werden müssen. Also da ist noch viel Raum, dass man das man zum einen die Schnittstellen zwischen KI-Algorithmen besser macht oder auch, dass man sozusagen komplexere Tasks, wie eben so eine ganze OP-Planung automatisch zum Beispiel lösen könnte.
Prof. Kuhn: Da ist ein spannendes Gebiet, was Sie da auch wieder ansprechen. Wir haben ja in der Vergangenheit zum Beispiel in diesen onkologischen Erkrankungen ja Tumor Boards gehabt, wo dann vielleicht die Radiologen, die Genetiker, die Onkologen, aber auch vielleicht die Pathologen, die die Gewebeproben untersucht haben, gemeinsam zu einer Entscheidung kommen. Und wir merken jetzt, dass in den einzelnen Bereichen jeweils auch KI-Algorithmen zum Beispiel in Radiologie eingesetzt werden, die diesen Diagnoseprozess unterstützen oder gegebenenfalls auch in der Pathologie. Wie sehen Sie so diese Integration zwischen den verschiedenen Modalitäten? Also werden wir zukünftig ein KI gestütztes Tumor Board haben, was die ganzen Modalitäten integriert und werden wir vor allem auch nicht nur Diagnosestellung, sondern vor allem auch Prognose oder Therapieansprechen, damit beleuchten können? Was ist Ihre Vision?
Prof. Lippert: Also diese Integration von verschiedenen Datenmodalitäten ist ein schweres Problem. Aber da arbeiten noch sehr viele Leute dran und da werden auch große Fortschritte gemacht. Also wie schon gesagt: Momentan haben wir eben KI auf jeder einzelnen von diesen Datenmodalitäten. Da werden Muster erkannt. Da werden dann im Endeffekt diagnoseunterstützende Dinge extrahiert aus diesen Daten. Und die werden dann eben von den Expert*innen, also von den Ärzt*innen ausgewertet und zusammengeführt, die in diesem Board sitzen. Ich denke, dass immer mehr graduell, mehr und mehr davon von dieser Datenintegration KI-gestützt wird. Und ich glaube, wenn man wirklich langfristig denkt - also ich möchte jetzt keine Zeit geben - ich weiß ja nicht mal mehr, was in fünf Jahren möglich sein wird oder nicht möglich sein wird. Es ist ganz schwer vorherzusagen, wird glaube ich, dieser Prozess mehr und mehr automatisiert werden.
Prof. Kuhn: Wir sehen ja aktuell, um vielleicht auch mal die andere Seite noch mal zu beleuchten, wir sehen auf der einen Seite im Bereich der Forschung eine unglaubliche, explosionsartige Erkenntnisgewinn und Möglichkeiten im Bereich von künstlicher Intelligenz. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel ins FDA-Verzeichnis von den zugelassenen Machine Learning Algorithmen schaue oder auch im American College of Radiology, was so im Bereich der Bildgebung an KI-Unterstützung schon alles auch zugelassen ist für die klinische Praxis. Dann ist das ein riesengroßes Delta zu dem, was man selbst an der Universitätsmedizin tagtäglich erlebt. Und vielleicht auch die Frage an Sie: Sie arbeiten ja auch in verschiedenen interdisziplinären oder klinischen Gruppen zusammen. Wo sehen Sie da die zentralen Hindernisse für eine klinische Implementierung und vielleicht auch Lösungsstrategien? Also wie können wir diese perspektivisch überwinden?
Prof. Lippert: Eine Sache habe ich ja schon genannt. Es ist ja nicht nur ein technisches Problem offensichtlich. Sondern die Nutzung dieser Tools ist manchmal so schwer und braucht schon selbst so viel Expertise, dass der Aufwand oft zu groß wäre. Also das ist schon mal die eine Sache. Dann hat man auch das Problem, dass es für medizinische KIs gibt es irgendwie doch sehr wenig Standards, muss man sagen. Das heißt, was man dann kriegt, ist auch sehr heterogen und damit umzugehen, dass das natürlich auch extrem schwer. Wir sehen auch, dass es oft Probleme gibt, was sozusagen die Reproduktion von irgendwelchen Ergebnissen in der Praxis gibt. Diese Machine Learning Algorithmen, die lernen ja immer basierend auf - also da wird ja nicht so programmiert, wie zum Beispiel jetzt ein Muster extrahiert wird oder sowas - sondern dem werden eben Beispiele gezeigt, wo man einerseits zum Beispiel das Bild und andererseits hat ein Arzt eben genau gesagt, welche Muster in diesem Bild jetzt relevant sind. Und wenn man dem Machine Learning Algorithmus ganz viele von diesen Mustern zeigt oder den Beispielen zeigt, dann lernt es eben das automatisch zu machen. Also sieht eben, welche Muster in den Bildern wichtig sind, um diesen gewünschten, diese gewünschte Ausgabe zu reproduzieren. Wenn jetzt allerdings die Beispiele, die dann in der Praxis relevant sind oder auf die es angewandt wird, irgendwie systematisch anders sind von denen, auf denen dieser Algorithmus trainiert wurde, dann wird er schlechter funktionieren. Das führt zum Beispiel dazu, dass Algorithmen, die vornehmlich auf zum Beispiel einer wohlhabenderen Patientenpopulation trainiert wurden, die zum Beispiel vor allem auf weißen, europäisch stämmigen Leuten basieren, dann nicht so gut funktionieren, wenn sie woanders eingesetzt werden, zum Beispiel auch auf afrikanisch stämmigen Leuten. Und davon sehen wir einige Beispiel auch in unserer eigenen Forschung. Und da Transparenz zu schaffen, welche Daten vorher eingesetzt wurden und welche Charakteristiken eben diese Trainingsdaten dazu haben - das ist extrem wichtig, wenn man möchte, dass das diese Maschinen Learning Algorithmen auch in der Praxis, die dieselbe Performanz zeigen, damit man dann eben die Anwendungsfelder abgleichen kann mit den mit den Trainingsbeispielen.
-
Minute 16:14 bis 20:49
Alissa Stein: Es ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da angesprochen haben, weil man das ja auch ganz häufig allein schon der Unterschied zwischen Männern und Frauen wird ja auch häufig da besprochen. Dass da die Datenlage natürlich die wichtigste Grundlage ist. Wenn wir schon über das Thema der Hindernisse sprechen, vielleicht können wir da auch einmal über die Herausforderungen bei der Einführung von KI-Lösungen weitermachen. Was muss denn da speziell auch im Umgang mit Patientinnen und Patienten beachtet werden? Also müssen die zum Beispiel auch ihr Einverständnis geben? Haben sie Vorbehalte, Sorgen? Was ist Ihre Erfahrung?
Prof. Lippert: Also wenn es darum geht, die Daten zu analysieren und zur Entwicklung von KI-Algorithmen zu verwenden - Dann braucht man natürlich den informed consent. Schwerer, glaube ich, wird es werden, wenn es darum geht, sozusagen die Anwendung zu sagen: „Ich möchte jetzt ohne KI behandelt werden“. Also das wird wahrscheinlich praktisch sehr schwer möglich sein, weil eben KI im Endeffekt auch nur ein Werkzeug ist, wie so viele andere medizinische Werkzeuge auch. KI ist jetzt schon in vielen Geräten drin.
Prof. Kuhn: Ja, also es ist ein wirklich herausforderndes Thema und man muss sagen an einigen Stellen wirklich auch noch Bestandteil, eigentlich zum einen von Forschungsprojekten und zum anderen natürlich auch von der Regulatorik, die durch diese technologische Welle an einigen Stellen auch überrollt wurde. Wir sehen das zum Beispiel, dass wenn wir jetzt KI-Algorithmen einsetzen, vielleicht im Rahmen von einer Sekundärbefundung, von der Computertomographie, da haben wir es ja auch nicht mit einer „Schwarz oder Weiß“ - Aussage zu tun. Es heißt ja dann auch nicht, der Lungentumor ist zu 100 % real vorhanden oder auf gar keinen Fall vorhanden. Sondern wir haben als Analyse dann häufig „Diese Veränderung ist mit einer 93-prozentigen Wahrscheinlichkeit ein Lungentumor oder mit einer 50-prozentigen oder vielleicht auch nur mit einer zehnprozentigen Wahrscheinlichkeit.“ Und da ergeben sich dann schon auch noch mal Implikationen, in welcher Art und Weise man das mit den Patientinnen und Patienten bespricht. Also wird es immer kommuniziert? Auch wenn dort vielleicht nur eine 50-prozentige oder eine zehnprozentige Wahrscheinlichkeit ist. Wie gehen wir damit um, mit vielleicht auch weiteren bildgebenden oder auch invasiven Maßnahmen? Also wie, in welcher Art und Weise tun wir unsere ärztliche klinische Befundung, die vielleicht auch von der KI-Befundung abweicht, integrieren und kommunizieren. Kommt es in den Arztbericht rein? Also wenn ich zum Beispiel menschlich befundet habe: Nein, meinem Eindruck nach irgendwie ist es eine normal befundene Lunge und KI-Algorithmus hat gesagt: Ja, mit einer zehnprozentigen Wahrscheinlichkeit könnte es einen Lungentumor darstellen. Und da muss man sagen, an diesen Stellen, also wie kommunizieren wir das mit dem Patienten? Wie dokumentieren wir das? Haben wir zum jetzigen Zeitpunkt auch standespolitisch für die Ärzteschaft noch wirklich Regulierungsbedarf? Und dann sind die Fachgesellschaften auch gefragt, dort Leitlinien und Best Practice auch zu etablieren.
Alissa Stein: Was würden Sie beide denn auch sagen, wann KI an ihre Grenzen stößt?
Prof. Lippert: Immer dann, wenn es sozusagen irgendwo angewandt wird, quasi in einem Gebiet, was sie während der Trainingsphase noch nicht gesehen hat. sozusagen während Entwicklungsphase KI-Algorithmen sind dann nicht so gut darin zu extrapolieren, sind nicht so gut wie Menschen darin, sich sozusagen in einem neuen Umfeld schnell zurechtzufinden und schnell Schlüsse zu ziehen.
Prof. Kuhn: Wir haben es derzeit mit einer Vielzahl von Algorithmen zu tun, die für eine ganz spezifische Fragestellung trainiert worden sind. Und wenn das, sagen wir mal, qualitativ hochwertig durchgeführt hat, das Ganze auch mit einer enormen Treffsicherheit dann auch bearbeiten können. Es fehlt allerdings die Generalisierbarkeit. Es ist immer noch „Artificial narrow Intelligence“, mit der wir es zu tun haben. Und ich glaube, die Limitationen vor allem von KI in der klinischen Anwendung ist, dass Nutzerinnen und Nutzer die Grenzen, in denen die KI funktioniert, nicht immer klar genug ist, Verständnis haben. Also sozusagen: Wo kann es eingesetzt werden? Aber wo ist auch die, die Grenze oder vielleicht auch der Bias drin? Herr Lippert hatte schon zweimal die Probleme zwischen europäischen und afrikanischen Populationen angesprochen, also zum Beispiel Hautkrebserkennung bei malignen Melanomen hat eine unterschiedliche Treffsicherheit bei Menschen mit hellen Hauttönen versus Menschen mit dunklen Hauttönen. Und da merken wir, dass bei der klinischen Applikation, KI an viele Grenzen stößt, einfach durch diese Heterogenität der der Menschen, aber auch von den von den klinischen Situationen und insbesondere auch dadurch, dass Menschen häufig gar nicht nur an einer Krankheit, sondern an mehreren Krankheiten leiden. Da wird es dann doch herausfordernd in der klinischen Anwendung.
-
Minute 20:49 bis 25:21
Alissa Stein: Ja, absolut. Aber was ich total spannend fand und was ich auch auf jeden Fall aus dieser Folge mitnehme, ist, dass die KI inzwischen schon ein Werkzeug ist, wie viele andere Werkzeuge auch in der Medizin. Deswegen würde mich jetzt auch abschließend sehr interessieren von Ihnen beiden: Wir fragen uns in dieser Folge auch künstliche Intelligenz in der Medizin. Ist es der entscheidende Faktor der Digitalisierung? Und da würde ich mich freuen, ob Sie da mal eine kurze Antwort „Ja oder Nein“ antworten würden? Herr Lippert, ich fange mal bei Ihnen an! Entscheidender Faktor der Digitalisierung?
Prof. Lippert: Ich würde sagen nein. Und zwar gibt es da noch so viele andere Hürden, die bei uns überwunden werden möchten. Im Endeffekt ist die Digitalisierung eine Voraussetzung zur Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz. Also ich sehe es andersherum. Wir brauchen die elektronische Gesundheitsakte. Wir brauchen die Verfügbarkeit von Gesundheitsdaten insgesamt. Das wird, das wird uns ermächtigen, mehr KI zu entwickeln, bessere KI zu entwickeln und am Schluss auch bessere Outcomes für die Patienten und Patientinnen zu erwirken.
Alissa Stein: Vielen Dank, Herr Kuhn. Wie ist Ihre Einschätzung?
Prof. Kuhn: Ja, da muss ich mich ja eigentlich fast schon mit „Ja“ positionieren. Ich denke, das, was Sie skizziert haben, also die Digitalisierungsprozesse, sind ganz entscheidend und das ist sicherlich auch ganz mein Herzensanliegen von meinem beruflichen Handeln. Ich denke, wenn wir das geschafft haben, die von Ihnen angesprochenen Integrationen von den Daten - Verfügbarkeit, Machen von Daten -durch elektronische Patientenakte und weitere Systeme. Dann an dieser Stelle wird die KI wirklich zu einem ganz, ganz entscheidenden Werkzeug für uns werden, um diese Informationsmassen auch bewältigen zu können.
Alissa Stein: Dann haben wir das geklärt. Lassen Sie uns noch einen Blick in die Zukunft werfen. Und Herr Kuhn, dafür übergebe ich an Sie.
Prof. Kuhn: Ja, Herr Lippert. Wir haben am Ende von dem Podcast eigentlich eine Frage, die wir immer jedem Experten oder jeder Expertin auch immer wieder stellen. Und da wollen wir mit Ihnen in die Zukunft schauen. Sie haben vorhin schon erwähnt, wie schwierig das ist, auch nur wenige Jahre in die Zukunft zu prognostizieren. Wir wollen es trotzdem versuchen und nehmen uns mal das Jahr 2030 vor. Wo, glauben Sie, werden wir im Jahr 2030 in Bezug auf Künstliche Intelligenz in der Medizin stehen? Gerne auch durch Ihren persönlichen Blick oder vielleicht Ihr persönliches Forschungsgebiet. Wo, glauben Sie, werden wir da in sieben Jahren stehen?
Prof. Lippert: Ich glaube, in sieben Jahren werden wir so weit sind, dass wir das genetische Risiko oder überhaupt das Krankheitsrisiko nicht nur genetisch - basierend auch auf Umweltfaktoren und - von Menschen besser beschreiben können und basierend darauf auch gezielt zum Beispiel Früherkennungsmaßnahmen ergreifen können bei solchen Leuten. Dass wir KI-Algorithmen auch in dieser Früherkennung einsetzen. habe dass, das zum Beispiel Bildgebung zum Beispiel gebracht. Aber da gibt es natürlich auch andere Daten, die man, die man sammeln könnte, indem man eben nach im Endeffekt nach Krankheitsmuster von früheren Krankheitsprozessen suchen kann. Und somit Krankheiten effektiver bekämpfen können, bevor sie wirklich einen Schaden anrichten können. Ich glaube auch, dass wir dann bestimmt auch erste Beispiele haben, wo KI-Algorithmen auch Handlungsempfehlungen und Prognose machen können. Also ich glaube auch, dass wir da sozusagen einen Schritt über die reine Mustererkennung und Diagnose machen können bis dahin, dass wir da schon positive Beispiele sehen.
Prof. Kuhn: Spannend, also 2030 sozusagen mehr Prävention und Früherkennung und nicht nur der klassische Reparaturbetrieb der Medizin, den wir schon lange kennen.
Alissa Stein: Ein wirklich total interessantes Themenfeld und was wir heute, glaube ich, auch alle mitnehmen können, ist eben, dass diese Datengrundlage das essenziellste ist und dass es da auch wichtig ist, dass wir die unterschiedlichsten Daten auch zur Verfügung bekommen und diese einspeisen können, um dann auch die richtigen präventiven Aussagen treffen zu können. Ja, und vor allem auch eine rasante Entwicklung - In sieben Jahren wird schon einiges mehr möglich sein als heutzutage. Deswegen, ich bin gespannt, was die Zukunft bringt und danke Ihnen, Herr Lippert, ganz, ganz herzlich, dass Sie uns heute einen Einblick gewährt haben.
Prof. Lippert: Ja, vielen Dank.
Prof. Kuhn: Ja, auch von meiner Seite. Herzlichen Dank! Herr Lippert, und ich bin gespannt, wenn wir uns vielleicht in sieben Jahren wiedersehen, was davon wahr geworden ist und wie die Medizin zu diesem Zeitpunkt aussieht. Vielen Dank.
Prof. Lippert: Ja, dann können wir ja vielleicht einfach noch mal so einen Podcast machen.
Alissa Stein: Und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, verabschieden wir uns auch von Ihnen. Vielen Dank fürs Zuhören und wir können Ihnen versprechen, es bleibt spannend. Und in der Zwischenzeit verfolgen sie uns auch gerne auf den verschiedensten Kanälen vom NewHealthGuide. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Auf Wiedersehen!
NewHealth.Podcast:
Zu allen Folgen
Digitalisierung sinnvoll umsetzen. Der Podcast zur Digitalisierung des Gesundheitswesens: Prof. Dr. med. Sebastian Kuhn und Moderatorin Alissa Stein sprechen regelmäßig mit Gästen aus der Branche. Ihre Themen: Spannende Best-Practice-Beispiele, interessante Visionen und praktische Erfahrungen, wie Entscheiderinnen und Entscheider im Krankenhaus Hürden bei der Digitalisierung meistern.